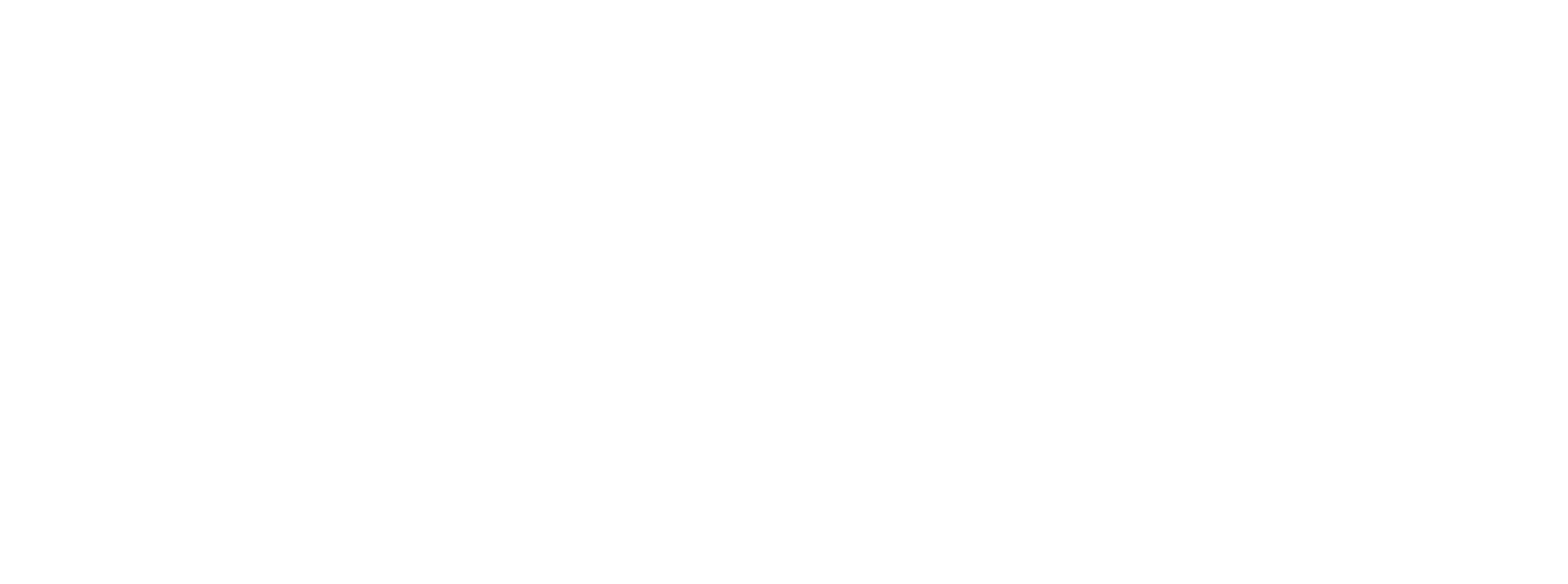3 Fragen an…

Prof. Dr. Andriy Goychuk
Gruppenleiter
Prof. Dr. Andriy Goychuk erforscht die Selbstorganisation lebender Materie über verschiedene Skalen hinweg – von Entzündungsprozessen und Zelldynamiken auf Gewebeebene bis hin zur Organisation im Zellkern und den Dynamiken von Proteinen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Entwicklung numerischer Verfahren und theoretischer Modelle, die auf Biophysik, statistischer Mechanik, Fluidmechanik und nichtlinearer Dynamik beruhen. Nach seiner Promotion in Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Jahr 2021 zu Zellbewegungen und Proteinmustern forschte er als Postdoktorand am Massachusetts Institute of Technology. Seine Arbeiten zur Chromatinorganisation und zu biomolekularen Kondensaten wurden durch die European Molecular Biology Organization gefördert. Seit 2025 leitet er eine Forschungsgruppe am CAIMed und am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.
1.
Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Physik, Biologie und Medizin. Welche Möglichkeiten eröffnet diese interdisziplinäre Perspektive für die medizinische Forschung?
Mathematische und biophysikalische Modelle können uns helfen, die Prinzipien zu verstehen, die der Organisation von Zellen und Geweben zugrunde liegen, und wie diese Organisation die Funktion steuert. Umgekehrt bieten dieselben Prinzipien die Möglichkeit, aufzudecken, wie und warum Funktionen während Krankheiten gestört werden. Beispielsweise habe ich kürzlich bei einem Besuch erfahren, dass sehr unterschiedliche Krankheiten (z. B. Virusinfektionen wie Zika und bestimmte genetische Defekte) ähnliche Phänomene (in diesem speziellen Beispiel eine Veränderung in der Architektur des Kernporenkomplexes) und klinische Ergebnisse (in diesem Fall Entwicklungsverzögerungen) aufweisen können. Ich denke, dass gemeinsame Organisationsprinzipien oder gemeinsame Fehlerquellen erklären können, warum verschiedene Krankheiten ähnliche Merkmale aufweisen können. Über die Erklärung des „Wie” und „Warum” hinaus ermöglicht die Modellierung auch die Prüfung der Durchführbarkeit einer potenziellen Intervention. Die übergeordnete Vision meiner Gruppe ist es, die physikalischen Prinzipien der biologischen Organisation zu integrieren, um zu verstehen, wie die Homöostase von Zellen und Geweben durch die Expression viraler Proteine während einer Infektion und durch die Zytokin-Signalübertragung während einer Entzündung gestört und nach der Genesung wiederhergestellt wird.
2.
Was fasziniert Sie daran, biologische Systeme mit physikalischen Prinzipien zu beschreiben – und welche neuen Perspektiven eröffnet dies für die Forschung innerhalb von CAIMed?
Die Biologie ist unglaublich chaotisch und komplex. Wo immer man hinschaut, kann man Inspiration finden, indem man sich einfach fragt: „Wie?“ Ich erinnere mich noch gut an das Staunen und die Begeisterung, als ich zum ersten Mal sah, wie sich Zellen in einem Modellversuch zur Blutgefäßbildung in vitro zu einem Netzwerk selbst organisierten. Für mich geht es in der Physik darum, die Frage „Wie?“ zu beantworten. Natürlich können die daraus resultierenden Modelle selbst herausfordernd, interessant und lohnend sein. Letztendlich geht es jedoch darum, dass die Physik darauf zugeschnitten ist, minimale Prinzipien zu destillieren, die eine gewisse Wahrheit über ein potenziell sehr komplexes System vermitteln. Eine starke Vereinfachung ist ein wichtiges Merkmal dieses Prozesses, da sie uns ein intuitives Verständnis ermöglicht, das zu einer Veränderung der Perspektive führen kann. In diesem Sinne ist das Scheitern eines Modells kein Fehler, sondern lehrt uns, was wir übersehen haben, und bietet uns damit eine systematische Möglichkeit, die Komplexität des Modells zu erhöhen. Nachdem die physikalischen Prinzipien eingegrenzt wurden, bietet maschinelles Lernen meiner Meinung nach die Möglichkeit, große und miteinander verbundene Datensätze zu skalieren und zu screenen. Ich freue mich sehr darauf, mit den anderen Mitgliedern von CAIMed zu diskutieren, wo dieser reduktionistische Ansatz hilfreich sein könnte oder von anderen Perspektiven profitieren könnte.
3.
Welche Möglichkeiten bietet CAIMed für den Transfer von KI in die klinische Praxis?
Ein konkretes Beispiel, das mir dabei in den Sinn kommt, steht in engem Zusammenhang mit einem Projekt und einer Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Einige virale Proteine lokalisieren sich in bestimmten Bereichen der Zelle, wie beispielsweise dem Nukleolus oder Transkriptionskondensaten. Bei anderen Pathologien führen Mutationen oder Fehlregulationen zu einer abnormalen Lokalisierung von Proteinen. Ich halte es für fantastisch, die Prinzipien und molekularen Merkmale, die der Proteinlokalisierung zugrunde liegen, besser zu verstehen. Dieses Verständnis könnte beispielsweise bei der Entwicklung von Medikamenten hilfreich sein. Dieses Problem steht in engem Zusammenhang mit Thermodynamik und statistischer Mechanik (z. B. chemische Potenziale und molekulare Wechselwirkungen), Chemie (z. B. Protonierung und Deprotonierung in Abhängigkeit vom pH-Wert) und Proteinfaltung (wo KI auf dem neuesten Stand der Technik ist) und ist unglaublich vielfältig und komplex (allein im Nukleolus wurden Tausende verschiedener Proteintypen gefunden). Ich stelle mir vor, dass meine Forschungsgruppe am CAIMed diese Herausforderung angehen wird, indem sie detaillierte Simulationen (grobkörnige Molekulardynamik) mit maschinellem Lernen kombiniert, um molekulare Merkmale und biophysikalische Modelle auf der Grundlage von First Principles zu extrahieren.